Wahl der Bundesstadt
Die Bestimmung eines mächtigen Zentrums für Parlament, Regierung und Verwaltung lässt sich kaum mit dem Geist des neuen Bundesstaates vereinbaren. Das Wort «Hauptstadt» soll gar nicht verwendet werden und selbst der bevorzugte Begriff «Bundesstadt» findet nicht Eingang in die Verfassung. Die Frage soll nur auf Gesetzesstufe geregelt werden. Der Vorschlag eines wechselnden Standorts und die Idee der Neuerrichtung einer Hauptstadt werden schnell verworfen. Kleinstädte wie Thun und Zofingen, die genannt werden, sind von vornherein chancenlos. Ernsthafter ist die Kandidatur des zentral gelegenen Luzern. Als vormaliger Hauptort des Sonderbunds zeigt es jedoch keinen Enthusiasmus für das neue Staatsgebilde. Die Entscheidung fällt somit zwischen Zürich und Bern. Zürich kann mit starker Wirtschaft, guter Infrastruktur und internationaler Ausrichtung trumpfen. Für Bern sprechen die Nähe zur Westschweiz und die Entfernung von der Grenze und möglichen Invasoren. Letztlich ist wohl die Befürchtung ausschlaggebend, in Zürich könnte sich zu viel Macht konzentrieren. Am 28. November 1848 entscheiden sich 58 Nationalräte für Bern und nur 35 für Zürich. Im Ständerat bekommt Bern 21 und Zürich 13 Stimmen. Auf Luzern entfallen 6 bzw. 3 Stimmen. 1 Nationalrat votiert für Zofingen. Damit wird Bern zum politischen Zentrum der Schweiz.
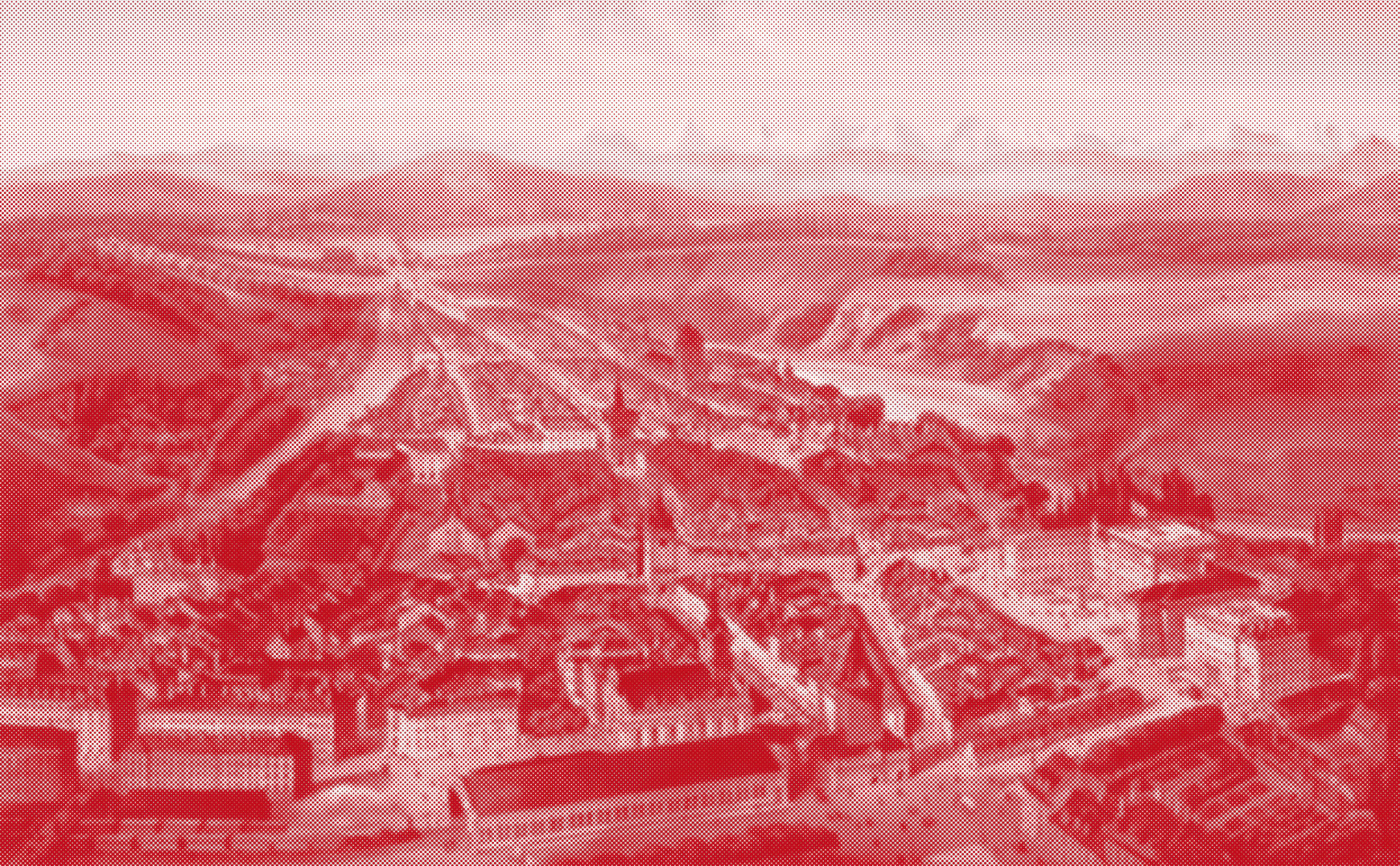
Geschäftige Zürcher vs. ruhige Berner
Im Wettstreit um die Hauptstadtwürde wird nicht mit Klischees über Land und Leute gespart. Für die «NZZ» weist Zürich eine «wohlhabende, bedeutende Bürgerschaft […], eine grossartige, gebildete Kaufmannschaft» auf, die eine «wohltuende, kosmopolitische Denkart und Hospitalität» pflege. Es biete somit den Parlamentsmitgliedern ein ideales Umfeld. Dieser «Lieblingssitz der Musen» sei für die Räte viel ansprechender als «die ernste melancholische Umgebung Berns», wo zudem «die grösste Armuth an Vereinigungsorten» herrsche.
Die Berner Zeitungen können Zürichs wirtschaftliche Dominanz nicht bestreiten, werten diese aber geschickt als Nachteil: Zürich sei «seiner industriellen Bevölkerung wegen zu wenig ruhig». Bei aller Bildung und Klugheit der Zürcher biete «eine industrielle, fabrizierende Bevölkerung zu wenig soliden, sichern, ruhigen Boden für die Bundesstadt». Bern eigne sich daher viel besser: «Die Berner sind ein schweizerisches Kernvolk, Ackerbauern und Viehzüchter, freisinnig, ruhigen Gemüths, von kräftigem Schlag.» Das sei für Bundesbehörden «eine breite, grossartige Unterlage». Nirgendwo sonst, so die Berner Presse weiter, würden die Ratsmitglieder «mehr Offenherzigkeit und Gemüthlichkeit, weniger Verstellung und Falschheit […] erfrischendere gesellige Unterhaltung» vorfinden. Unbekannt ist, inwieweit diese Polemik zum Abstimmungssieg Berns beigetragen hat.
Von Segessers Dilemma
Philipp Anton von Segesser wird als einziger Katholisch-Konservativer aus dem Kanton Luzern in den Nationalrat gewählt. Dort sieht er sich sogleich mit der Frage konfrontiert, wo Parlament und Regierung ihren Sitz haben sollen. Auch Luzern zählt zu den Kandidaten. Von Segesser muss abwägen: Einerseits könnte seine Heimatstadt nationale Ehre und internationale Bekanntheit erlangen. Als Hauptstadt hätte sie grösseres politisches Gewicht und könnte ökonomische Vorteile erwarten. Auch steht die Regierung seines Kantons klar hinter der Kandidatur. Andererseits sind hohe Kosten zu befürchten. Zudem hat sich die Mehrheit der abstimmenden Luzerner gegen die Bundesverfassung ausgesprochen. Der Kanton und er selber haben im Sonderbundskrieg für den Erhalt des Staatenbunds gekämpft. Soll nun ausgerechnet Luzern das Aushängeschild des neuen Bundesstaates werden? Am 28. November 1848 werfen die Nationalräte ihren Stimmzettel in die Urne. Auf 6 Papierchen steht der Name «Luzern». Von Segesser hat keines von ihnen eingeworfen. Er hat auch für keine andere Stadt votiert, sondern ist angesichts seines Dilemmas der Ausmarchung schlicht ferngeblieben. Als führender Oppositionspolitiker wird er in Bern aber noch oft genug Gelegenheit zum klaren Positionsbezug haben.
